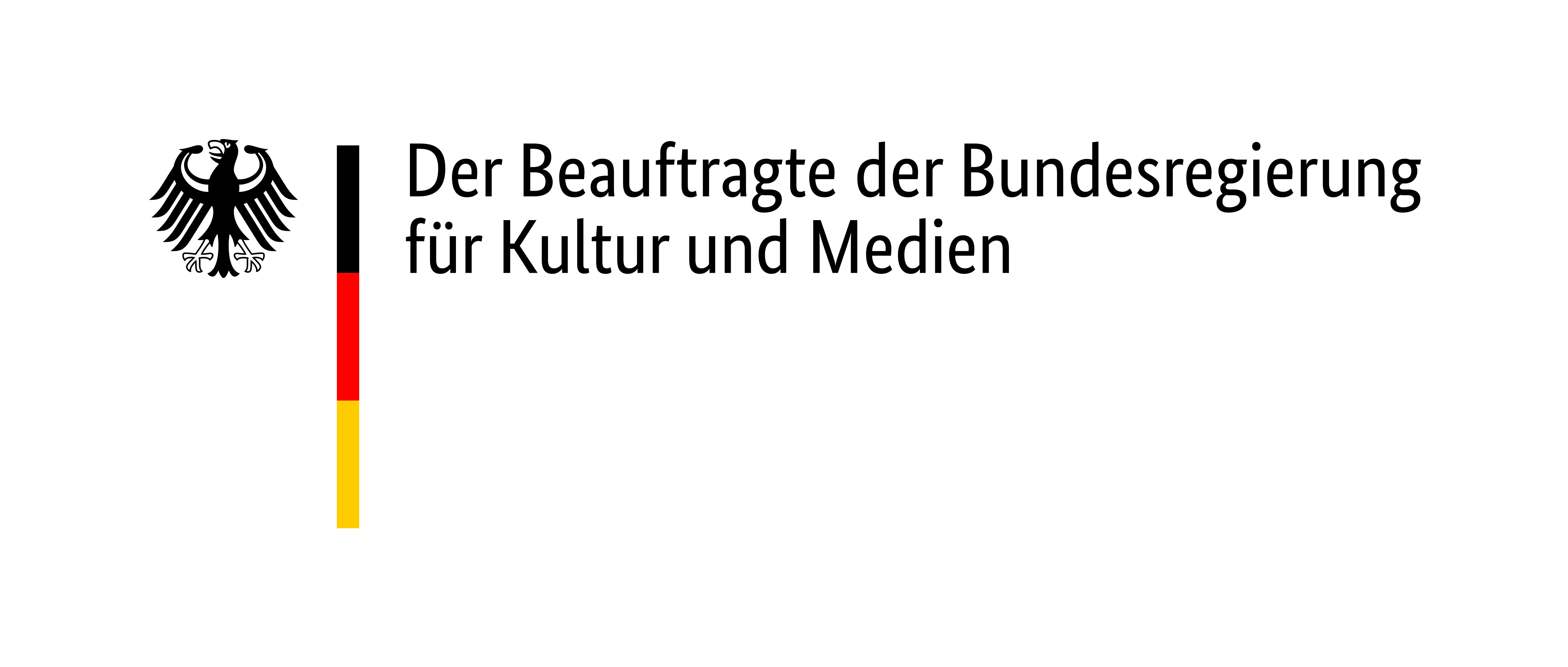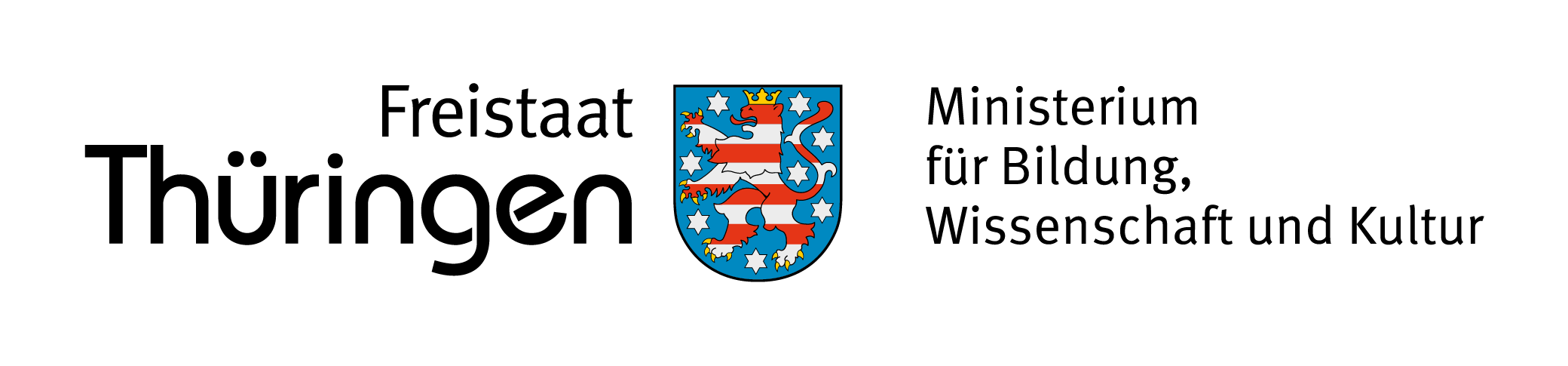Die Masseneinweisung traf die SS unvorbereitet. Hastig ließ sie fünf scheunenähnliche Behelfsbaracken errichten. In diese Unterkünfte, die keine Böden, Fenster oder Öfen hatten, zwängte die SS jeweils rund 2.000 Männer. Als sanitäre Anlagen dienten lediglich zwei offene Latrinen. Ein Stacheldraht trennte die 10.000 Quadratmeter große Zone vom übrigen Häftlingslager.
Die Männer litten an Hunger, unter chronischem Wassermangel, an Krankheiten und Erfrierungen. Hinzu kamen Gewaltorgien durch die SS. Nur wer zustimmte, Deutschland zu verlassen und seinen Besitz aufzugeben, durfte das Lager wieder verlassen. Nach wenigen Wochen war der Großteil der Männer bereits nicht mehr in Buchenwald.
Eine Typhusepidemie, die über die Abwässer des Lagers auf angrenzende Ortschaften übergriff, zwang die SS dazu, das Sonderlager im Februar 1939 aufzulösen und abzureißen. Auf dem Gelände entstanden später Werkstätten und die Häftlingskantine. Insgesamt verloren 250 Männer im Pogromsonderlager ihr Leben, an das heute ein Gedenkstein in deutscher, hebräischer und russischer Sprache erinnert.