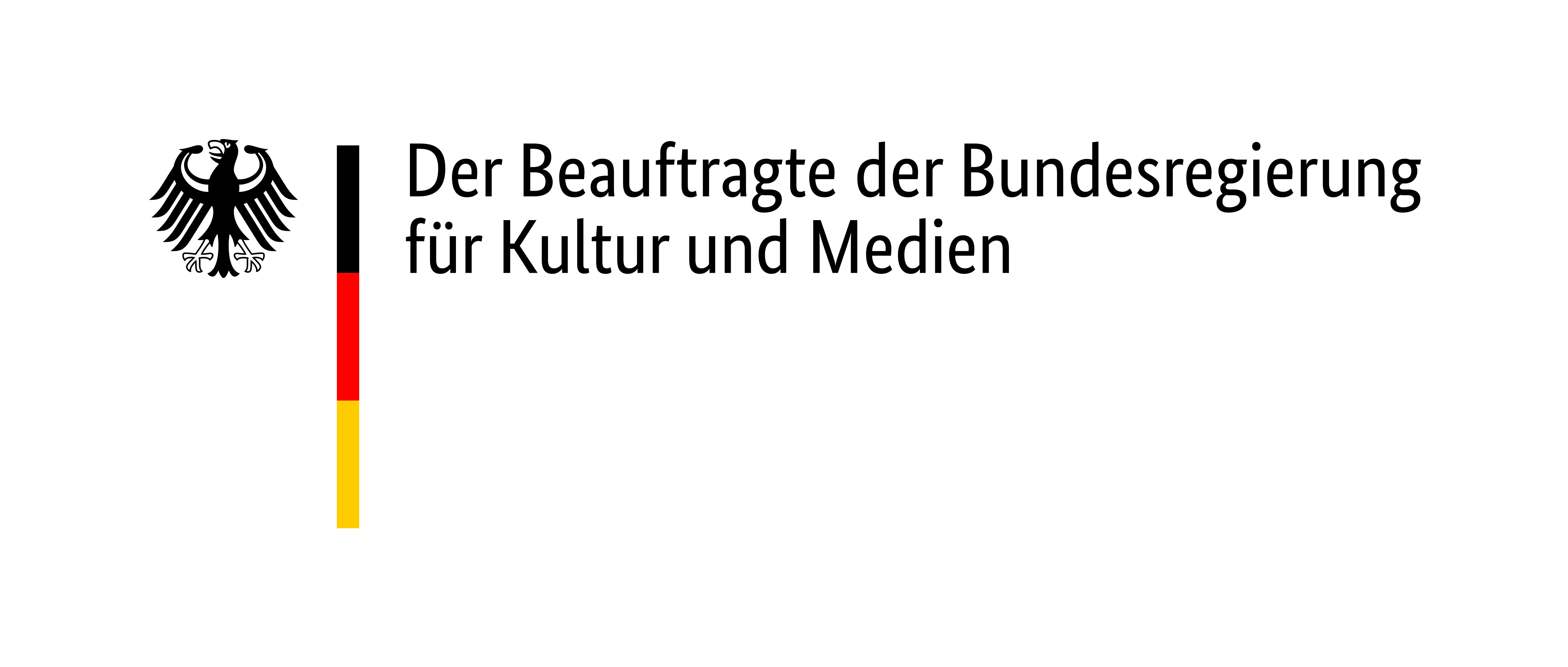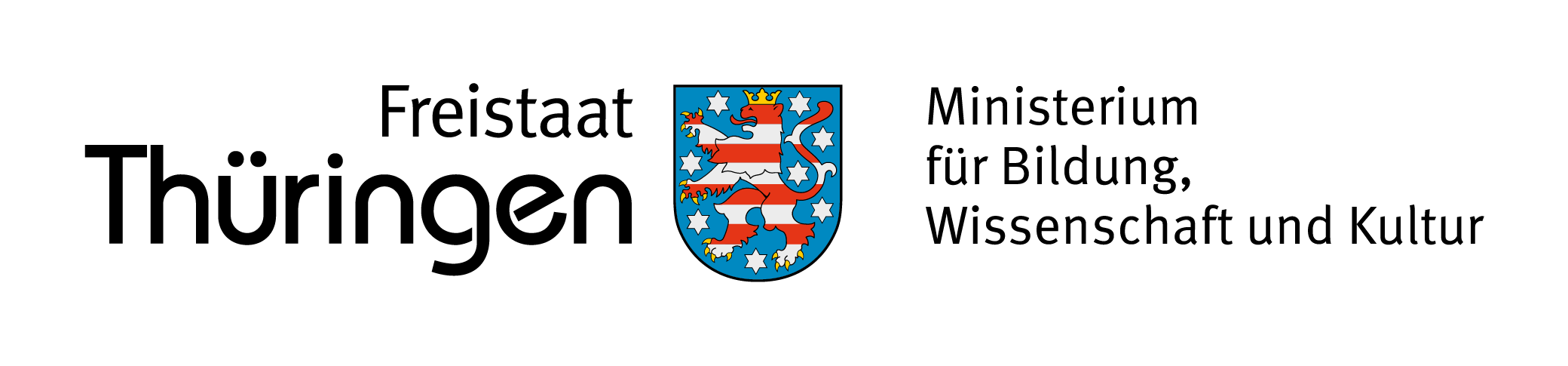Gedenkstein polnisches Sonderlager 1939/40 (1954)
Auf dem ehemaligen Appellplatz des KZ Buchenwald erinnert seit 1954 ein Gedenkstein an das Sonderlager 1939/40. Nach dem weitgehenden Abbruch des Lagers 1952 sollte sein oberer Bereich neu gegliedert und eine würdigende Gestaltung erhalten. Links und rechts des wiederhergerichteten Appellplatzes wurden dafür die Bereiche der Sonderlager 1938/39 und 1939/40 mit gleichförmigen Rasenflächen, Wegen und Gedenksteinen gestaltet.
In dem Sonderlager litten und starben nach Kriegsbeginn sowohl Polen als auch österreichische Juden, die vom NS-Regime für staatenlos erklärt worden waren. Der Gedenkstein erinnert sie als „polnische Patrioten“ und sollte den internationalen Charakter des antifaschistischen Widerstandskampfes bezeugen. Der Text auf dem Gedenkstein wurde 1985 geändert, als die Zahl der Inhaftierten des Sonderlagers von 5.300 auf 2.098 korrigiert wurde.

Gedenkstein jüdisches Sonderlager 1938 (1954)
Ein 1954 verlegter Gedenkstein erinnert an das jüdische Sonderlager, das sich 1938/39 auf dem westlichen Teil des Appellplatzes befand.
Anlässlich des Gedenkens an die Novemberpogrome im Jahre 1988 wurden erstmalig offiziell Vertreter Israels in die DDR eingeladen. Im Zuge dessen wurde statt einer englischen die hebräische Inschrift in den Gedenkstein eingebracht.
Der jüdische Gedenkstein war bis 1990 der einzige, der sich mit seinem Verweis auf den „faschistischen Rassenwahn“ nicht direkt in die übergeordnete Erzählung des kommunistischen Widerstandskampfes einordnete.

Gedenkstein für sowjetische Kriegsgefangene (1954)
Ein Gedenkstein erinnert seit 1954 an die rund 3.500 sowjetischen Kriegsgefangenen, die innerhalb des Häftlingsbereiches in einem Sonderlager inhaftiert waren.
Die ursprüngliche Planung von 1953, das Lagergelände als Gedenkstätte lediglich im oberen Bereich links und rechts des ehemaligen Appellplatz zu gestalten, wurde bereits 1954 ergänzt um zwei Gedenksteine für die sowjetischen Kriegsgefangenen – neben jenen für die ermordeten Angehörigen des britischen Geheimdienstes und an den Lagerwiderstand im Häftlingskrankenbau.
Die Erzählungen zum Widerstand der sowjetischen Kriegsgefangenen ordneten sich ein in das übergeordnete Narrativ der DDR vom illegalen Internationalen Lagerkomitee unter der Führung kommunistischer Häftlinge.

Gedenkstein „Pferdestall. Mordstätte für 8.483 sowjetische Soldaten“ (1954)
Ein Gedenkstein und eine umlaufende Mauer markieren seit 1954 den ehemaligen Pferdestall und erinnern an den hier begangenen größten Massenmord von Buchenwald.
Der Gedenkstein ehrt die sowjetischen Kriegsgefangenen, die aus ideologischen und rassischen Gründen in der Genickschussanlage erschossen wurden: „Sie kämpften und starben als Helden ihres sozialistischen Vaterlandes.“ Damit steht der Text im Gegensatz zur damaligen Politik der Sowjetunion gegenüber ihren in Gefangenschaft geratenen Soldaten, die pauschal der Kollaboration mit dem Feind verdächtigt wurden. Erst Ende der 1950er-Jahre – nach dem Tod Stalins – setzte eine vorsichtige Rehabilitation der als „Verräter“ Gebrandmarkten ein.

Gedenkstein für ermordete Angehörige der britischen und kanadischen Streitkräfte (1954)
Am Block 17 erinnert seit 1954 ein Gedenkstein an die Angehörigen alliierter Geheimdienste, die zur Ermordung nach Buchenwald deportiert wurden.
Ab 1942 diente der Block 17 zur zeitweiligen Quarantäne kleinerer ankommender Gruppen, so auch von 37 Angehörigen alliierter Geheimdienste, die im August 1944 mit einem Transport aus Paris eintrafen. Zuvor waren sie im besetzen Frankreich als Agenten des britischen Geheimdienstes und als Verbindungsleute zur Résistance verhaftet worden.
Im September/Oktober 1944 wurden die meisten von ihnen im Keller des Krematoriums erhängt. Lediglich drei der Männer – Harry Peulevé, Edward Yeo-Thomas und Stéphane Hessel – konnten mit Hilfe des Lagerwiderstandes durch einen Identitätstausch mit bereits verstorbenen Häftlingen gerettet werden.

Gedenkstein am ehemaligen Häftlingskrankenbau (Ende der 1950er Jahre)
Der Gedenkstein erinnert den ehemaligen Häftlingskrankenbau (HKB) ausschließlich als „einen der bedeutendsten Punkte der illegalen Widerstandsorganisation“.
Die Erinnerung an die Untergrundorganisation des Lagers dominierte seit den 1950er-Jahren die Darstellung Buchenwalds in der DDR. Die stringent auf die als vorbildlich dargestellte Rolle der Kommunisten ausgerichtete Erzählung ließ das Leiden der Häftlinge – allein im HKB wurden Hunderte von den SS-Ärzten mit Injektionen getötet – nahezu unsichtbar werden.