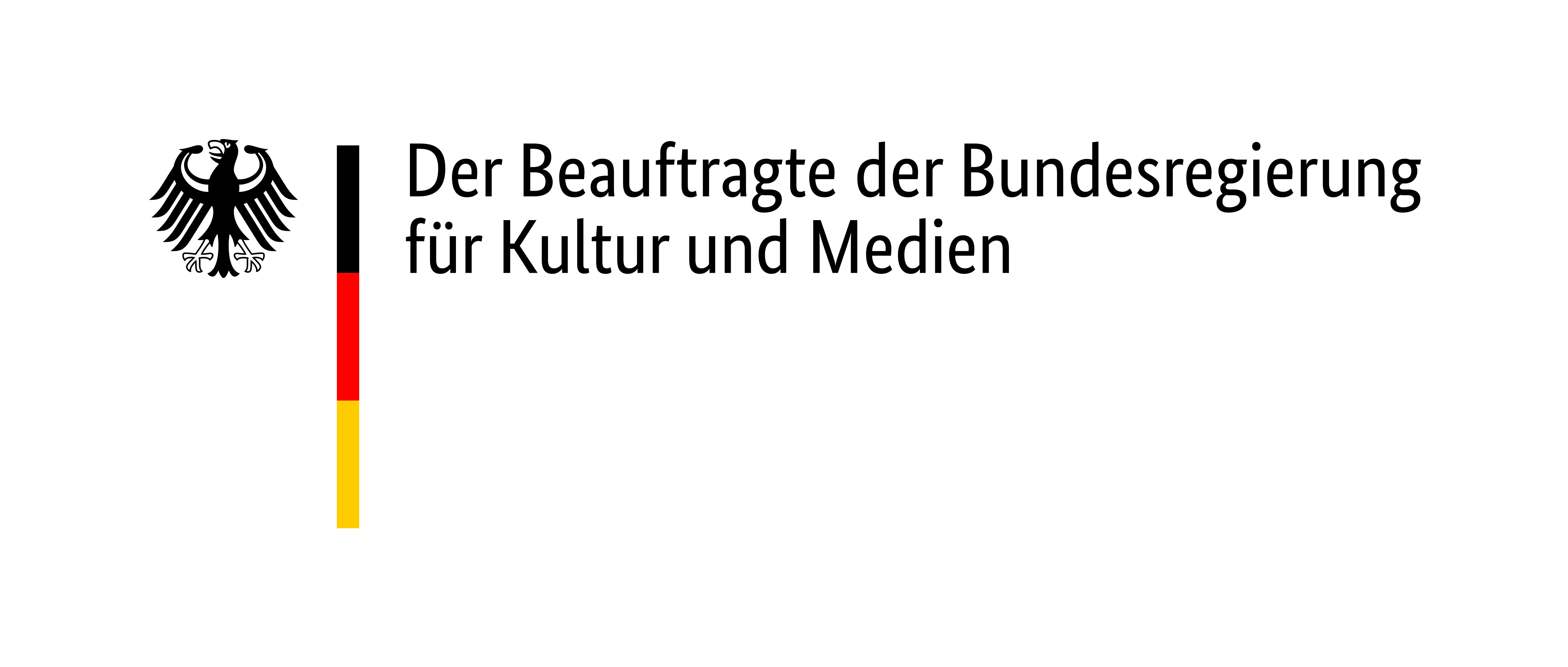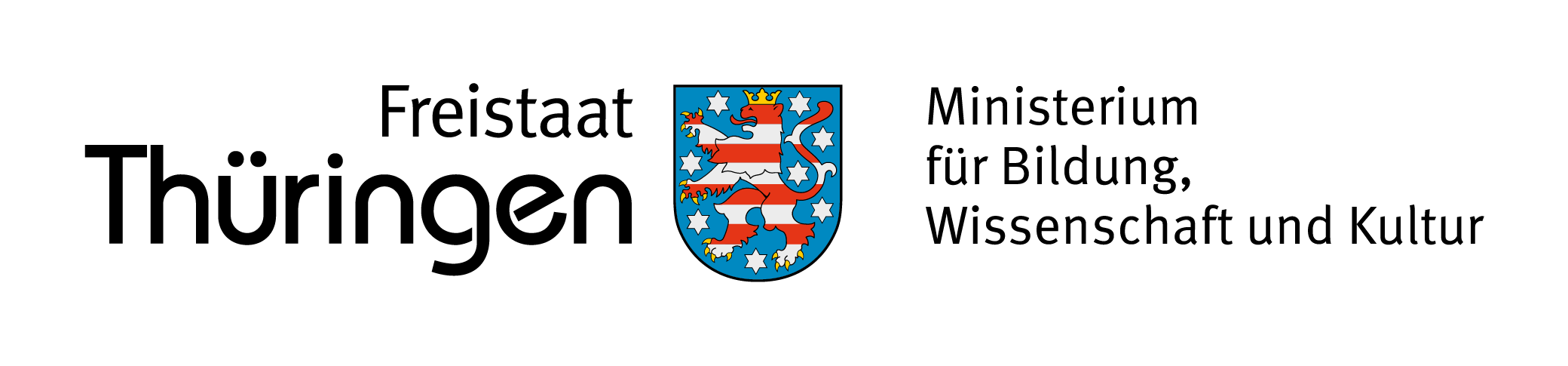Nach der Befreiung Weimars sah sich die Stadt vor die Frage gestellt, wie sie mit ihrer jüngeren Vergangenheit umgehen sollte. Bereits unter amerikanischer Besatzungsherrschaft begann die Säuberung des Stadtbilds von Relikten der NS-Zeit. Parallel dazu trat eine Gruppe ehemaliger Buchenwaldhäftlinge um Richard Großkopf dafür ein, das Gedenken an die (politischen) Gefangenen des KZ auch prominent im Stadtbild zu verankern. Auch der Watzdorfplatz mit seinen beiden Denkmälern geriet hier in den Blick. Schon zu diesem Zeitpunkt sprach man
Realisiert wurde ab Ende November 1945 zunächst der Abriss der alten Denkmäler, zudem benannte die Stadtverwaltung das Areal in Erinnerung an die damals geschätzte Zahl der Toten in Platz der 51.000 um. Die nächsten zwei Jahre blieb der zum Teil von Ruinen gesäumte Platz jedoch baulich praktisch unverändert, auch weil für die Gestaltung eines Buchenwalddenkmals andere Optionen erwogen wurden, etwa am heutigen Jorge-Semprún-Platz.
Am 14. September 1947, dem dritten Tag der Opfer des Faschismus, nahm die kurz zuvor gegründete Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) den Platz der 51.000 symbolisch in Besitz, wenngleich ihre ehrgeizigen Gestaltungsentwürfe – zunächst zwei große Figurengruppen links und rechts der Straße – auch unter dem Eindruck der ökonomischen Notlage nicht zur Ausführung kamen. Die Ausschmückung des Areals blieb ebenso dürftig wie improvisiert. 1952 korrigierte die Stadt Weimar den Namen, neuen Erkenntnissen über die Opferzahlen folgend, in Platz der 56 000.
Im selben Jahr formulierte die VVN einmal mehr ein ambitioniertes Neubauprojekt, das neben der Errichtung einer Denkmalsanlage auch Büroräume und andere Einrichtungen vorsah, um dem Platz von der flankierenden Ruinenlandschaft zu befreien. Die Auflösung der VVN jenseits der Lagerkomitees als Überlebenden-Netzwerk der DDR im Februar 1953 – vorgeblich, weil ein genuin antifaschistischer Staat keine eigene Organisation ehemaliger NS-Opfer bedürfe – bedeutete das vorläufige Ende dieser Planungen.