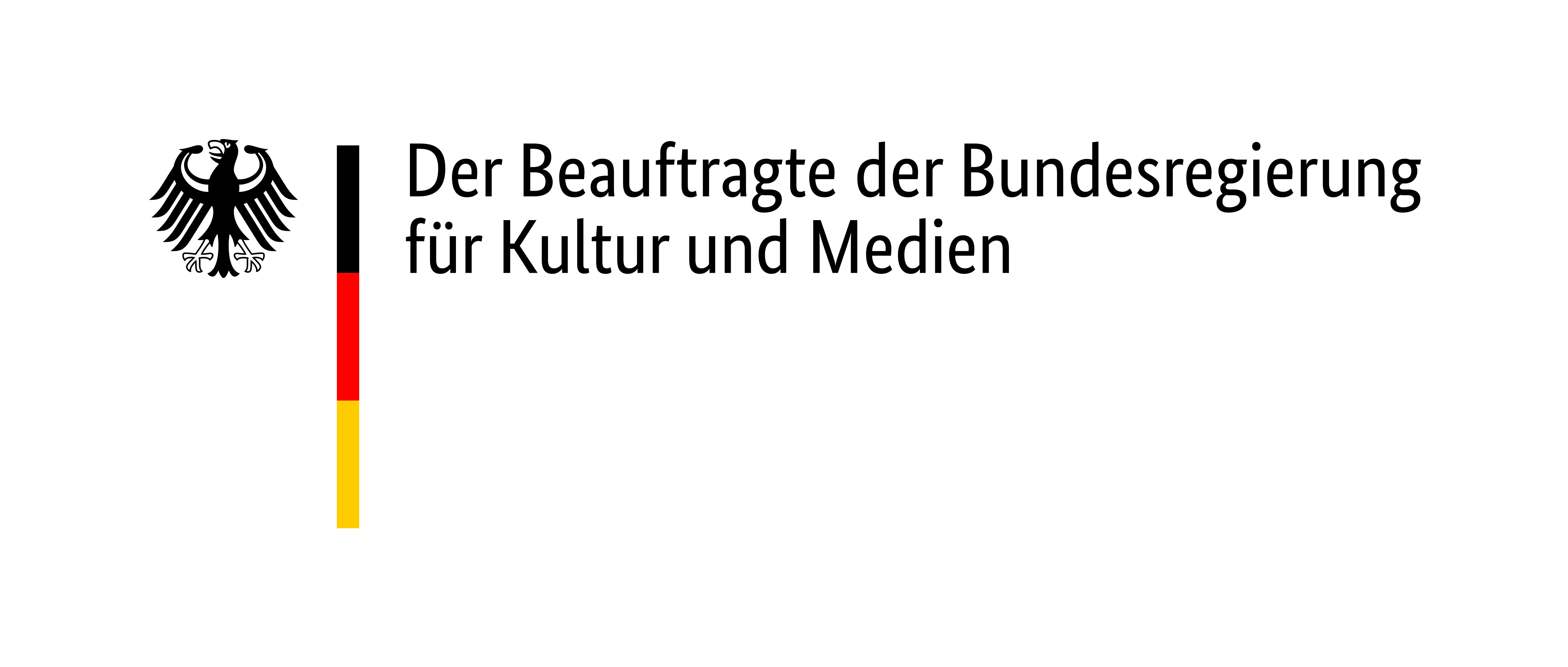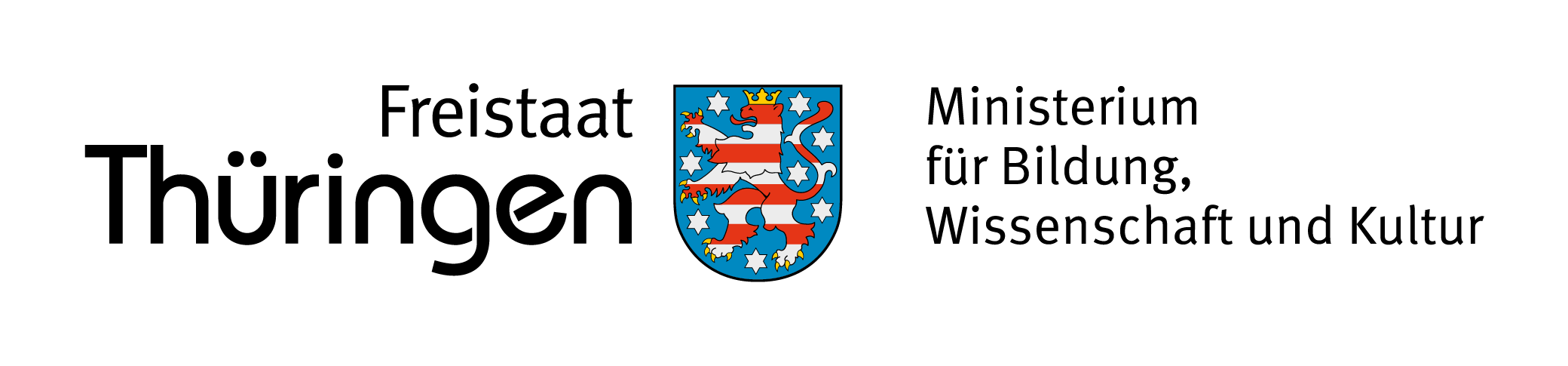In den folgenden Jahren etablierte sich ein Kanon von jährlichen Anlässen, an denen das Thälmann-Denkmal im Zentrum von Veranstaltungen stand oder wie etwa für die Maidemonstrationen zumindest prominenter Durchgangsort für die Festprozessionen war. Veranstaltungen aus Anlass von Thälmanns Geburtstag oder dem Tag seiner Ermordung wurden noch Mitte der 1980er Jahre gerade zu runden Jubiläen mit tausenden Teilnehmern begangen.
Doch auch Anlässe wie die Vereidigung von Angehörigen der Betriebskampfgruppen oder die Aufnahmeveranstaltungen für die Angehörigen der sozialistischen Jugendorganisationen, der Jung- und Thälmannpioniere und der Freien Deutschen Jugend, fanden vor dem Denkmal ihren Platz. Der auf der Mauer hinter der Thälmann-Statue prangende Sinnspruch und die Gestalt der Geehrten als vermeintlicher Wegweiser und Vorkämpfer ließen sich wie von Anfang an beabsichtigt flexibel instrumentalisieren. Gleichzeitig nahmen die Inszenierungen im Laufe der Jahre den Charakter von einstudierten Ritualen an, bei denen die Parolen trotz wechselnder Nuancen zunehmend als stets dieselben zu erkennen waren.
Eine innere Verbindung zum Ort und den hier Geehrten, ob nun Thälmann selbst oder den im Platznamen gewürdigten anderen Opfern des KZ Buchenwald, empfanden wohl nur noch eine Minderheit der Teilnehmenden. Das ursprüngliche Motiv für die Besetzung des Platzes mit Inhalten des Gedenkens für die Toten von Buchenwald trat zurück – verlagerte sich dieses doch zunehmend auf die Nationale Mahn- und Gedenkstätte auf dem Ettersberg. Im Zuge der touristischen Rückbesinnung auf das klassische Erbe Weimars geriet das Bahnhofsviertel ins Hintertreffen und dessen Gebäude begannen Anzeichen des Verfalls zu zeigen. Am Platz der 56.000 stand Thälmann allein, und diese prominente Rolle war es auch, die den Fortbestand des Denkmals in Frage stellen sollte, als der Staat, der ihn auf einen Sockel gehoben hatte, 1989/90 plötzlich zusammenbrach.