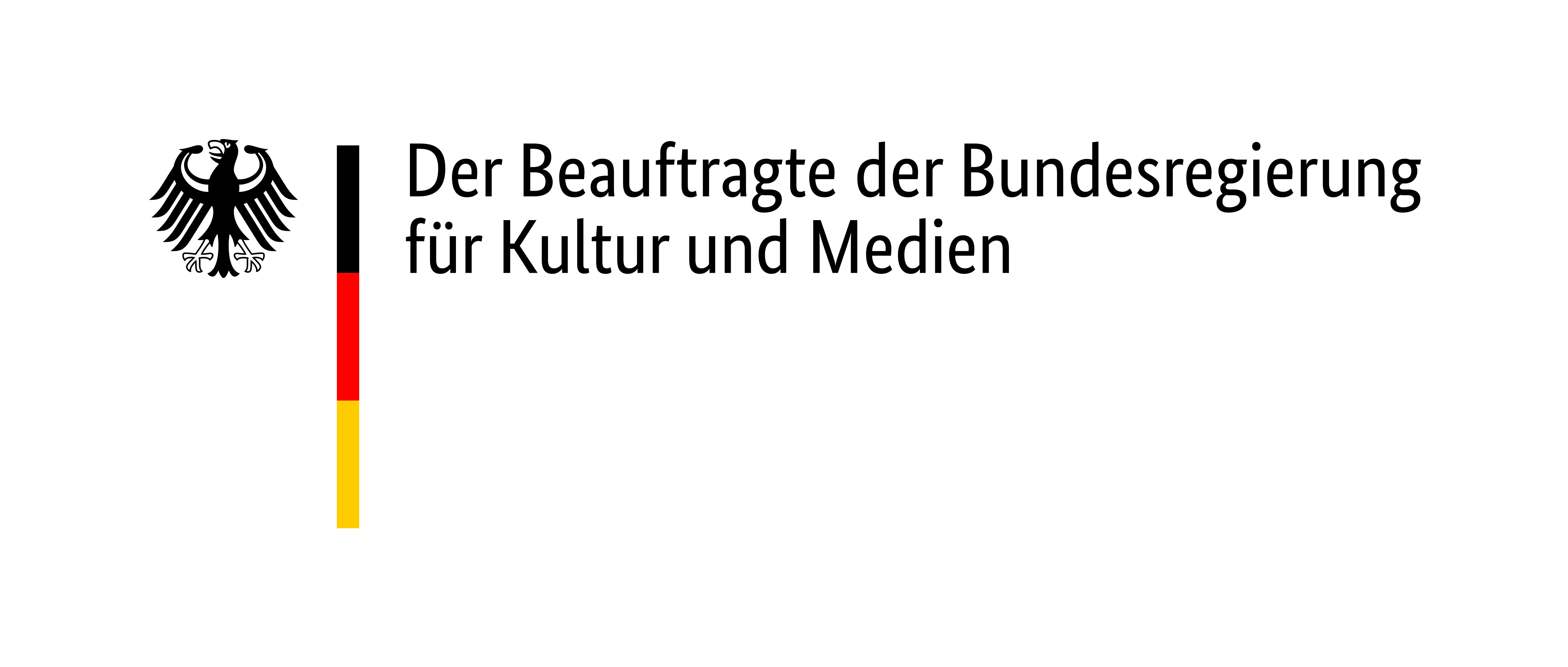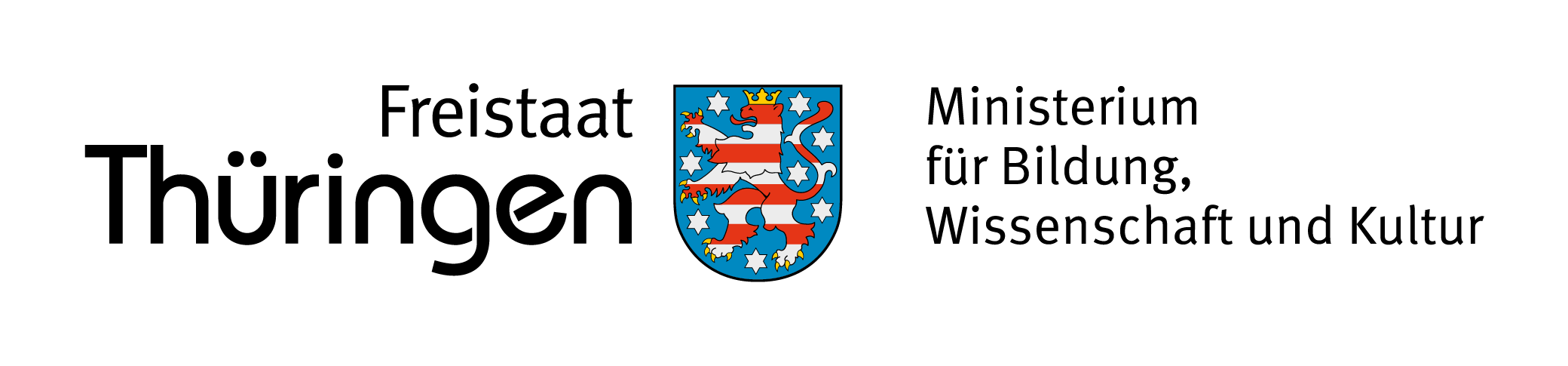Das im Format ungewöhnliche, beinahe quadratische Bild zeigt einen Seehafen mit Landungsstegen, Kahn und aussegelndem Boot, mit einer im Dunst von Wasser und Wolken verschwimmenden altholländischen Stadtsilhouette aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, aus der sich einzelne Gebäude wie die Kirche herausheben. Eine in holländische Tracht gekleidete Frauengestalt im Vordergrund zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters an. Sie symbolisiert die Hoffnung des in das KZ Buchenwald deportierten Malers Henri Pieck auf eine Rückkehr in die Heimat: Er hat in diesem Bild seine Sehnsucht nach der heimatlichen Landschaft und seinen Angehörigen, seine Hoffnung auf Freiheit und Rückkehr nach Hause zum Ausdruck gebracht.
„Von verhafteten Kunstmalern“, so der Buchenwaldhäftling Eugen Kogon, dem späteren Autor des Buches „Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager“, „verlangten die SS-Führer Gemälde aller Art. Bezahlt wurde dafür entweder überhaupt nichts oder lediglich eine Handvoll Zigaretten. Hingegen verkauften die ‚Erwerber’ die Bilder nicht selten um teures Geld in Bekanntenkreisen weiter. Von dem holländischen Maler [...] Pieck gab es in der Buchenwalder SS-Führerschicht mindestens zwei Dutzend wertvoller Werke, besonders Porträts. Der Künstler hatte immerhin den Vorteil davon, dass er nicht in irgend einem Steinbruch oder Schachtkommando zugrunde ging, sondern, wenn auch als Sklave dieser lächerlichen Parvenüs, in seinem Beruf tätig sein und sich Beziehungen schaffen konnte, die ihn dann vor dem Tode retteten […].“
Dies ist das einzige bekannte Beispiel dieser Kunstproduktion des Malers. Besitzer war der frühere Tropenarzt im Afrikakorps der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg Stabsarzt Dr. med. Ernst Reichelt (1905-1967) aus Hamburg. Von Februar 1944 bis März 1945 war Reichelt im „Seruminstitut“ der „Abteilung für Fleckfieber- und Virusforschung des Hygiene-Instituts der Waffen-SS“ des KZ Buchenwald tätig und lebte mit Frau und 5 Kindern in unmittelbarer Nachbarschaft zum KZ (in Gaberndorf). Nach dem Krieg ließ er sich in Westdeutschland nieder. Fast 30 Jahre nach seinem Tod übergaben die Kinder das Bild aus Familienbesitz der Gedenkstätte Buchenwald, damit es „den krassen Widerspruch zu den heimlich gezeichneten Bildern der furchtbaren Realität darstellt“.
Zur Biografie
Henri Christiaan Pieck (Han Pieck) wird am 19. April 1895 in der nordholländischen Hafenstadt Den Helder als Sohn einer Seefahrerfamilie geboren. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Anton, der später durch seine altholländischen Motive und Winteransichten fast jedem Niederländer bekannt wird, nahm er in der Schulzeit Zeichenstunden. Henri Pieck studiert in Den Haag, später an der Rijksakademie Amsterdam und erwirbt die Lehrbefugnis. Dann zieht es ihn in die weite Welt: 1919 beeindruckt ihn die Ungarische Räterepublik. In den folgenden Jahren trifft er Vertreter der niederländischen Arbeiterbewegung und entwirft 1921 ein Plakat gegen die Hungersnot in der Sowjetunion. Eine Begegnung mit dem Maler Piet Mondrian bestärkt ihn darin, nicht nur als „freier“ Künstler zu arbeiten, sondern seine Kunst für soziale Ziele einzusetzen. In den folgenden Jahren gestaltet er zahlreiche Plakate und wird ein bekannter Ausstellungsarchitekt. Er ist unter anderem für die Leipziger Messe tätig und gestaltet im Auftrag des niederländischen Außenministeriums Messeausstellungen in Liège, Genf, London, Paris, Madrid. Parallel entsteht ein grafisches und malerisches Werk, in dem Aktmalerei, Varietésujets und soziale Themen dominieren.
Im Juni 1941 wird Henri Pieck verhaftet, weil in seinem Atelier in Den Haag die illegale kommunistische Zeitung „De Vonk“ hergestellt wird; am 2. April 1942 wird er in das KZ Buchenwald deportiert. Dort gehört Henri Pieck zum holländischen Lagerwiderstand und zur engeren Führung der geheimen internationalen Lagerorganisation. Er findet Unterschlupf im Kommando „Virusforschung
Nach dem Krieg überarbeitet er seine Skizzen und veröffentlichte sie Ende 1945 im Verlag „Het Centrum“ Den Haag sowie 1949 im VVN-Verlag GmbH Berlin-Potsdam in einer Mappe. Vor allem durch die Umschlaggestaltung von Jugendbüchern wie Pietje Bell und Dick Trom, durch Stadtansichten von Amsterdam und Paris und durch seine Porträts ist der in den Niederlanden einem breiten Publikum bekannt. Am 12. Januar 1972 stirbt Henri Pieck in Den Haag.