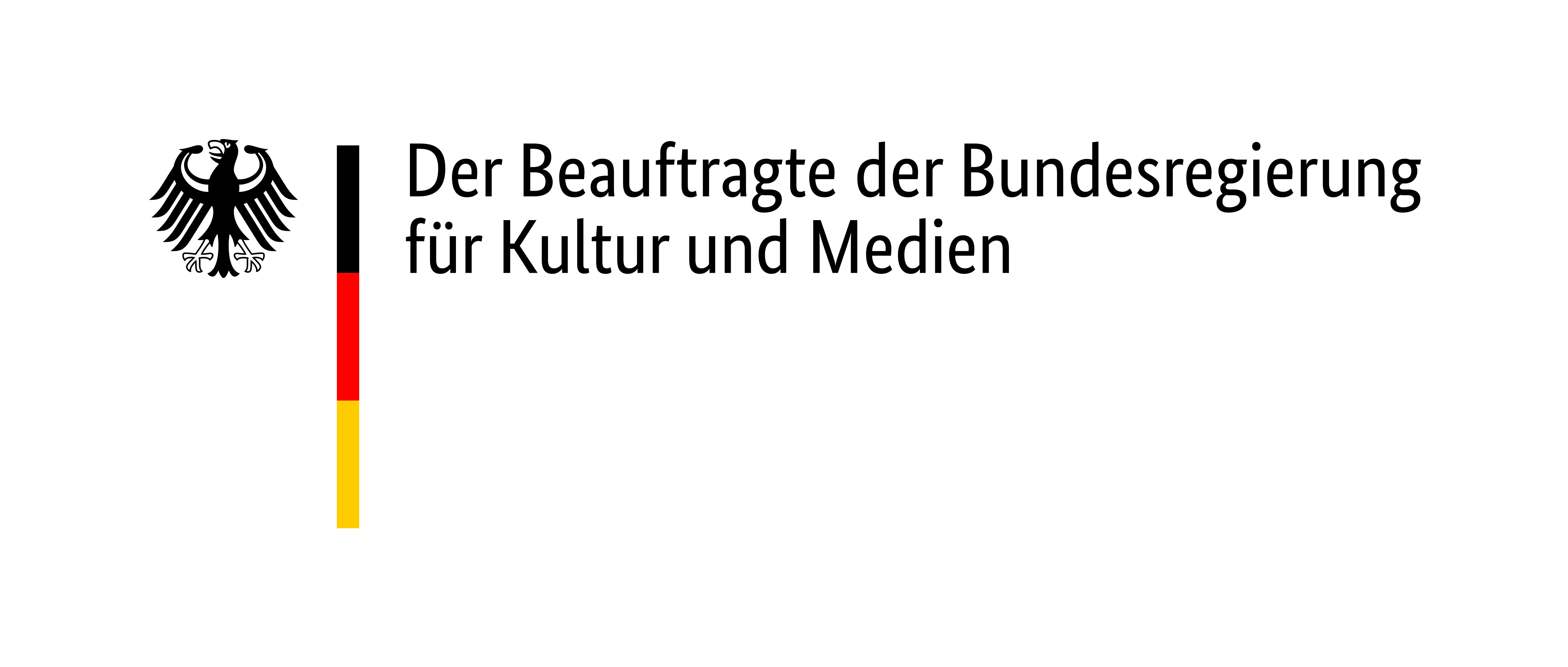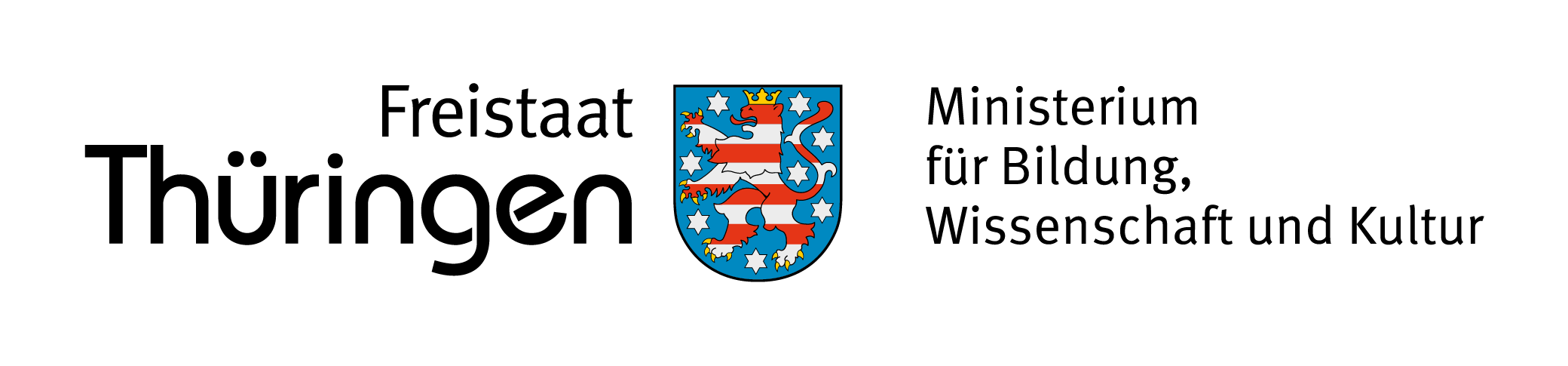Um von den vielfältigen Expertisen innerhalb unserer Gedenkstätte zu profitieren und alle Abteilungen von Anfang an am Entstehungsprozess zu beteiligen, haben wir am 15. Januar zum Kick-Off-Meeting ins Tagungshaus geladen.
Vladislav Drilenko - Iryna Kashtalian - Julia Landau - Anne-Christine Hamel - Christian Ernst Otto ©Gedenkstätte Buchenwald

Wie wird eine Ausstellung garantiert langweilig? Zu viele Texte, keine Struktur, nichts zum Hinsetzen – so lauteten die Antworten der Teilnehmenden im „Mentimeter“. Das Speziallagerteam stellte erste Ideen und Planungen zum Ausstellungsprojekt vor und diskutierte sie mit den Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen der Gedenkstätte. Es ging darum, möglichst viele Perspektiven auf dieses neue Projekt „Erarbeitung der Speziallagerausstellung“ einzunehmen, Bedenken, Wünsche und Erwartungen zu äußern und zu besprechen. In Gruppen beschäftigten uns unter anderem folgende Fragen: Was ist uns wichtig, welche Themen können wir neu beleuchten, was wird in der didaktischen Arbeit gebraucht, welche Bedürfnisse haben Besucherinnen und Besucher? Wie funktionieren multimediale Angebote zur Speziallagergeschichte, wie die neue, auf Tablets bereitgestellte Web-Anwendung „Welche Quellen sprechen?“.
Ausgehend von dem Gedanken, dass die Ausstellung innerhalb der Gedenkstätte ganz besonders von der Bildungsarbeit vor Ort leben wird, widmete sich eine weitere Gruppe den vielfältigen didaktischen Fragen und Herausforderungen: Wie kann die Ausstellung angelegt sein, um sich innovativ, flexibel und offen in die Zeitebenen vor Ort einzugliedern? Wie kann ihre komplexe Geschichte ohne detailliertes Vorwissen oder Zeitbudget dargestellt werden, ohne sie zu vereinfachen – oder gar zu trivialisieren? Wie kann die sowjetische Internierungspraxis als Teil der Geschichte Buchenwalds kritisch in den Blick genommen werden, ohne die nationalsozialistische Vernichtungspolitik zu bagatellisieren, für die der Ort ein ganz besonderes Mahnmal ist?
Losgelöst von den drei Zeitebenen vor Ort widmeten wir uns zudem der Frage, wie die Geschichte des Speziallagers Nr. 2 auch in der Lebenswelt von Heranwachsenden im 21. Jahrhundert ankommen kann. Wie sie in Anbetracht gesellschaftlicher Krisen und Herausforderungen der Gegenwart einen Beitrag dazu leisten kann, Reflexionsprozesse anzuregen und eine kritische Meinungsbildung zu fördern. Und – gedanklich im 21. Jahrhundert angekommen, ging es abschließend um unser besonderes Anliegen, wie die künftige Ausstellung von Anfang an inklusiv gedacht sein kann, um tatsächlich dem Anspruch gerecht zu werden, eine Ausstellung für ALLE zu sein.
Und dann war es soweit: Der offizielle Startschuss war gefallen und unsere Arbeit konnte beginnen!