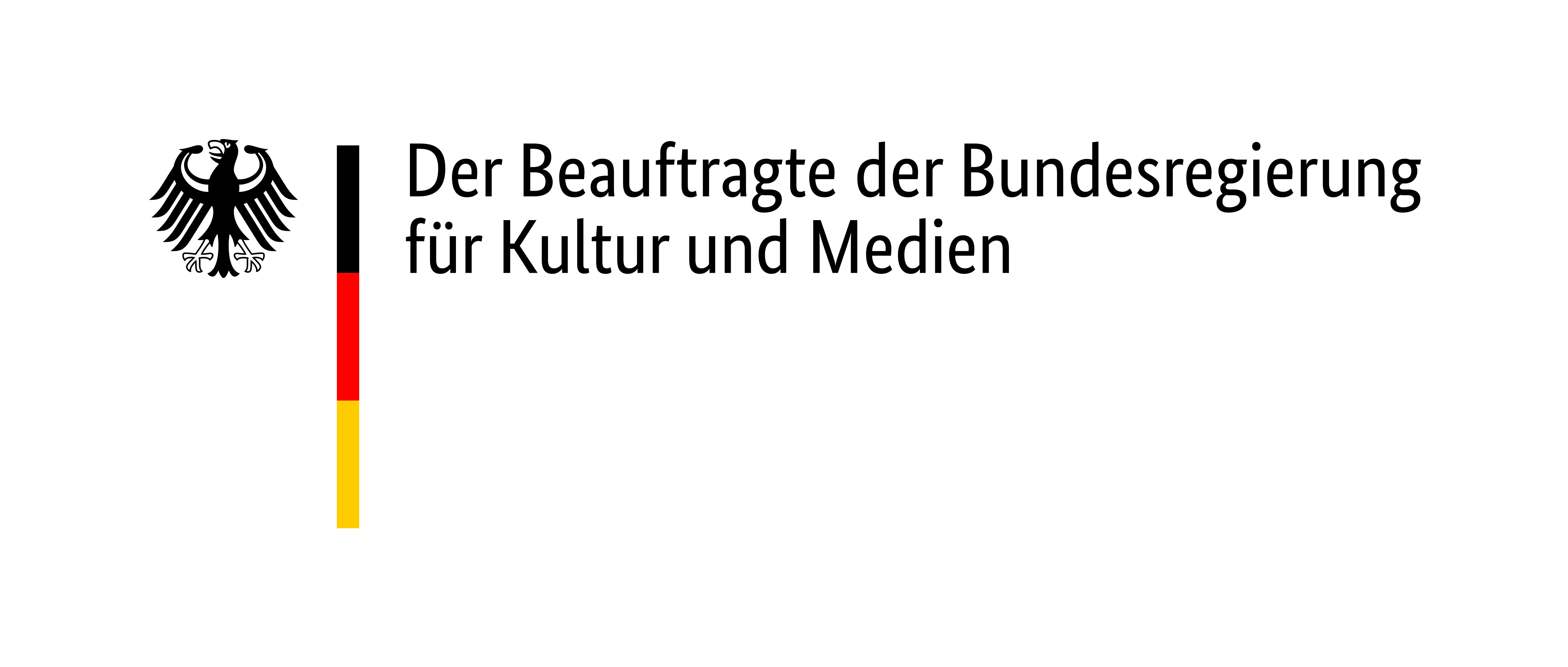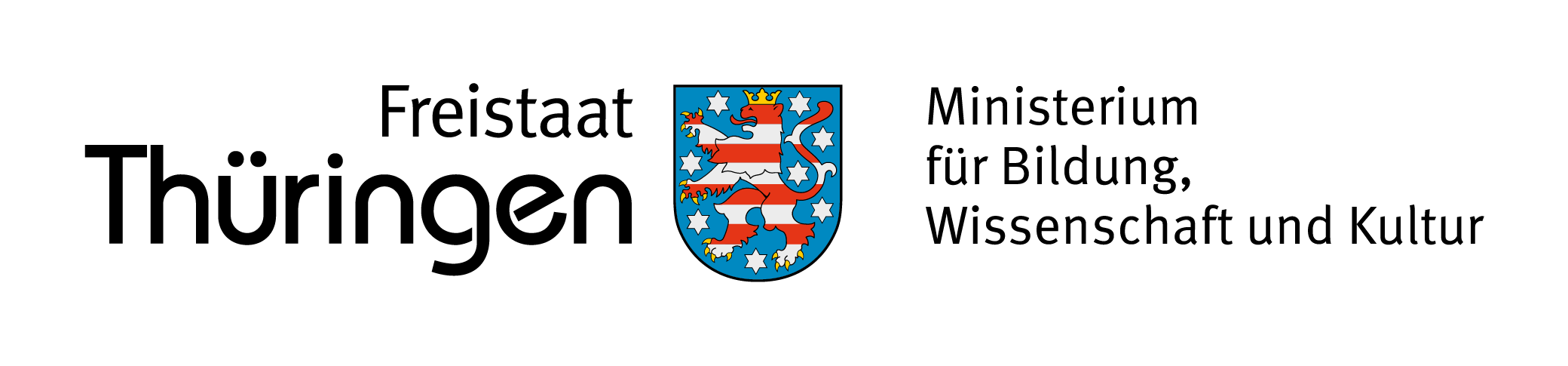Das Team "Speziallager-Ausstellung" zusammen mit Kolleg:innen aus Belarus, Deutschland und Polen organisierte ein Seminar „Geschichte und Menschenrechte. Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der Sowjetischen Besatzungszone“ für Studierende aus drei Ländern.




Vom 25. bis 30. November 2024 fand in Weimar ein besonderes Seminar statt, das junge Menschen aus Deutschland, Polen und Belarus zusammenbrachte. Organisiert wurde es von einem engagierten Team der Kustodie 2 der Gedenkstätte Buchenwald, der
Das Seminar „Geschichte und Menschenrechte. Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der Sowjetischen Besatzungszone“ bot den 22 Studierenden eine Plattform, um gemeinsam die Spuren des Nationalsozialismus in Weimar und Osteuropa zu erkunden, über Entnazifizierung zu sprechen und sich mit Fragen der Erinnerungskultur an Orten mit verschiedenen Zeitschichten auseinanderzusetzen.
Einblicke und Diskussionen
Die Teilnehmenden tauchten tief in die Geschichte ein: von der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus bis hin zur Nachkriegsgeschichte Thüringens. Besuche im Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, in der Gedenkstätte Buchenwald und an historischen Orten in und um Weimar, Vorträge von Expert:innen wie Prof. Dr. Annette Weinke und Diskussionen mit Fachleuten halfen, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen. Besonders intensiv setzten sich die Studierenden mit der Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nr. 2 in Buchenwald auseinander.
Zukunft gestalten
Ein Highlight des Seminars war der Austausch über die Gestaltung der neuen Ausstellung zur Geschichte des Sowjetischen Speziallager Nr. 2. Die Studierenden gaben wertvolles Feedback und betonten, wie wichtig es ist, verschiedene Perspektiven – auch internationale – in die Erinnerungsarbeit einzubeziehen.
Zum Abschluss besuchten die Teilnehmenden das Buchenwald-Mahnmal und den Glockenturm in Begleitung des Programmkoordinators der EJBW, Dr. Boris Stamenić aus Zagreb, Kroatien und diskutierten über die aktuellen Herausforderungen der Erinnerungskultur in ihren Ländern. Besonders beeindruckend war die Offenheit, mit der auch kontroverse Themen angesprochen wurden.
Gemeinsam für eine reflektierte Erinnerungskultur
Das Seminar war ein inspirierender Schritt in Richtung einer gemeinsamen europäischen Auseinandersetzung mit der „unbequemen“ Vergangenheit. Es zeigte, wie junge Menschen aus verschiedenen Ländern durch Dialog und Zusammenarbeit neue Perspektiven entwickeln können – und so einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten.