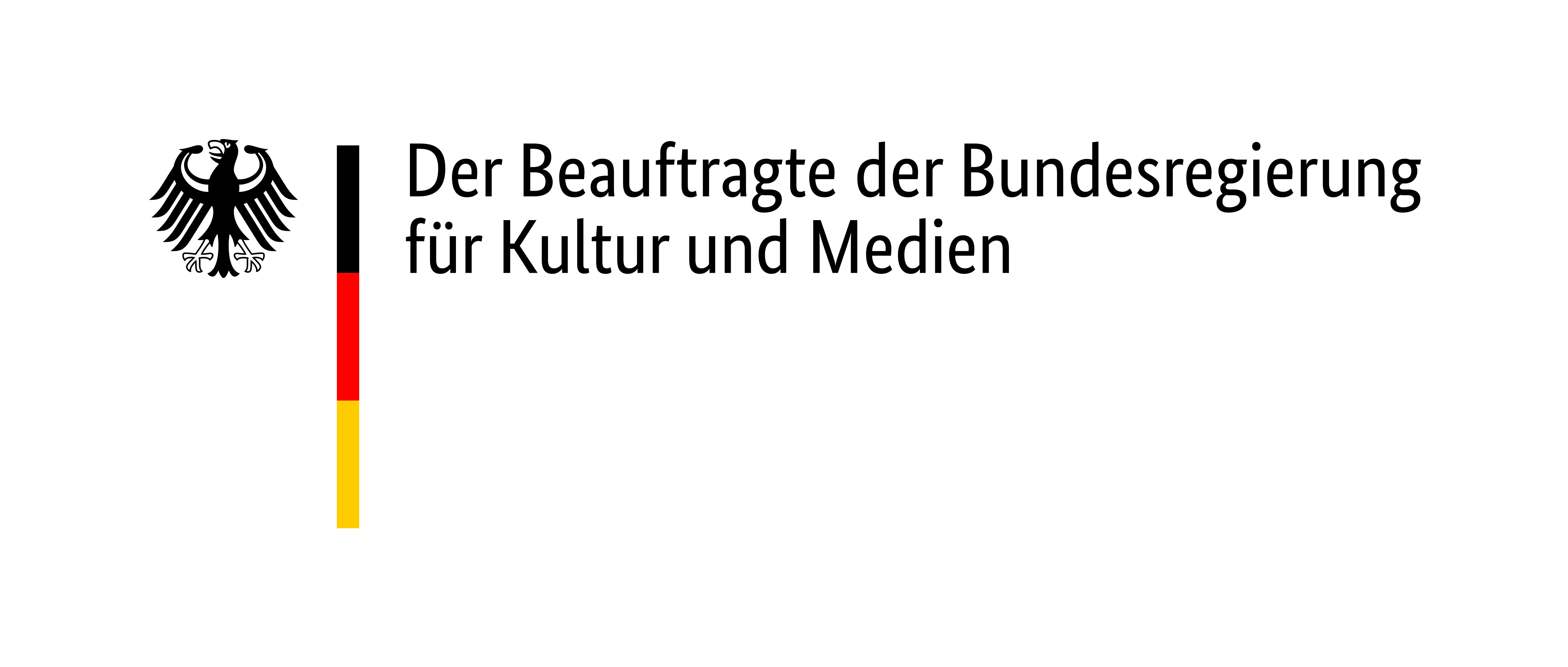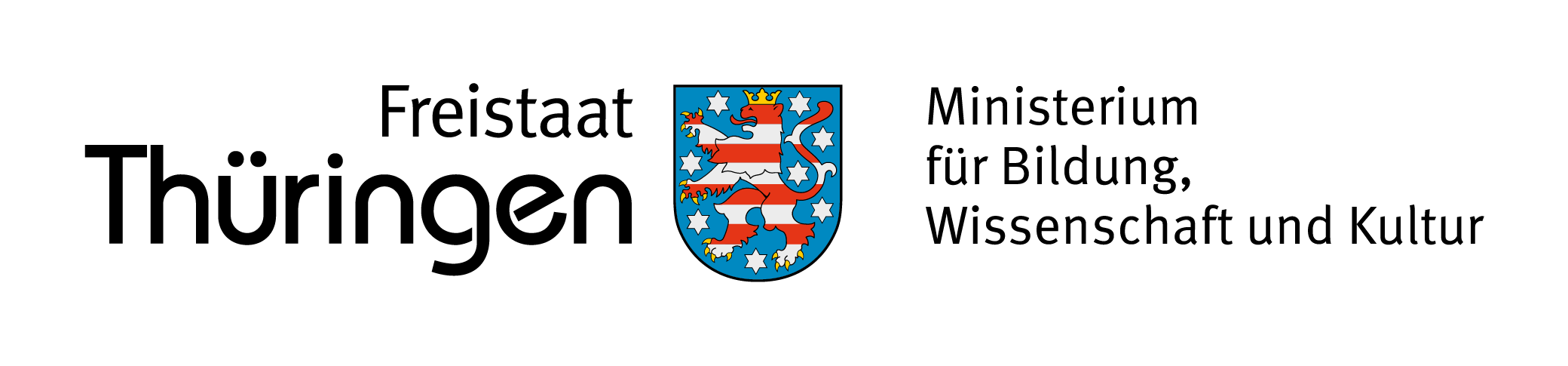Am 11. April 1945 befreite die US-Armee das KZ Buchenwald. Zusammen mit befreiten Häftlingen aus dem Lagerwiderstand organisierte sie die Ernährung und medizinische Versorgung der Überlebenden.
Anfang Mai 1945 richteten US-amerikanische Armeeangehörige ein „Displaced Persons Center“ ein. Befreite Häftlinge und ausländische Zwangsarbeiter:innen wurden dort untergebracht und versorgt.
Ärzt:innen und Sanitäter:innen versorgten die Kranken in Behelfskrankenhäusern. Ehemalige Nationalsozialist:innen wurden verpflichtet, bei
Aufräumarbeiten und in der Küche zu helfen. Zugleich versuchten die US-Amerikaner:innen, die Rückkehr der befreiten Häftlinge in ihre Heimat zu organisieren.
Anfang Juli 1945 befanden sich noch 14.000 Menschen im Displaced Persons Camp. Nach Übernahme Thüringens durch die sowjetische
Besatzungsmacht wurde das Camp noch einige Wochen als sowjetisches Repatriierungslager betrieben. Im August 1945 wurde es geschlossen.

Auf der Höhe der ehemaligen Hauptwache des KZ Buchenwald befand sich der Eingang in das DP-Camp. Als „Displaced Persons“ (DP) bezeichneten die Westalliierten befreite nichtdeutsche ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter:innen.

In den ehemaligen SS-Unterkünften richteten die Amerikaner Behelfskrankenhäuser ein, in denen befreite Häftlinge gepflegt wurden. Vor Betreten des Krankenhauses mussten die befreiten Häftlinge ihre Kleidung ablegen, um die Verbreitung von Krankheiten einzudämmen.

Die Rückkehr der befreiten Westeuropäer:innen erfolgte meist sehr schnell. Schwieriger gestaltete sich die Rückkehr von Osteuropäer:innen. Für befreite Jüdinnen und Juden gab es häufig keinen Weg mehr zurück: Ihre Siedlungen waren zerstört; oft waren alle Angehörigen ermordet worden. Sie blieben deshalb bisweilen jahrelang in DP-Camps in Westdeutschland.