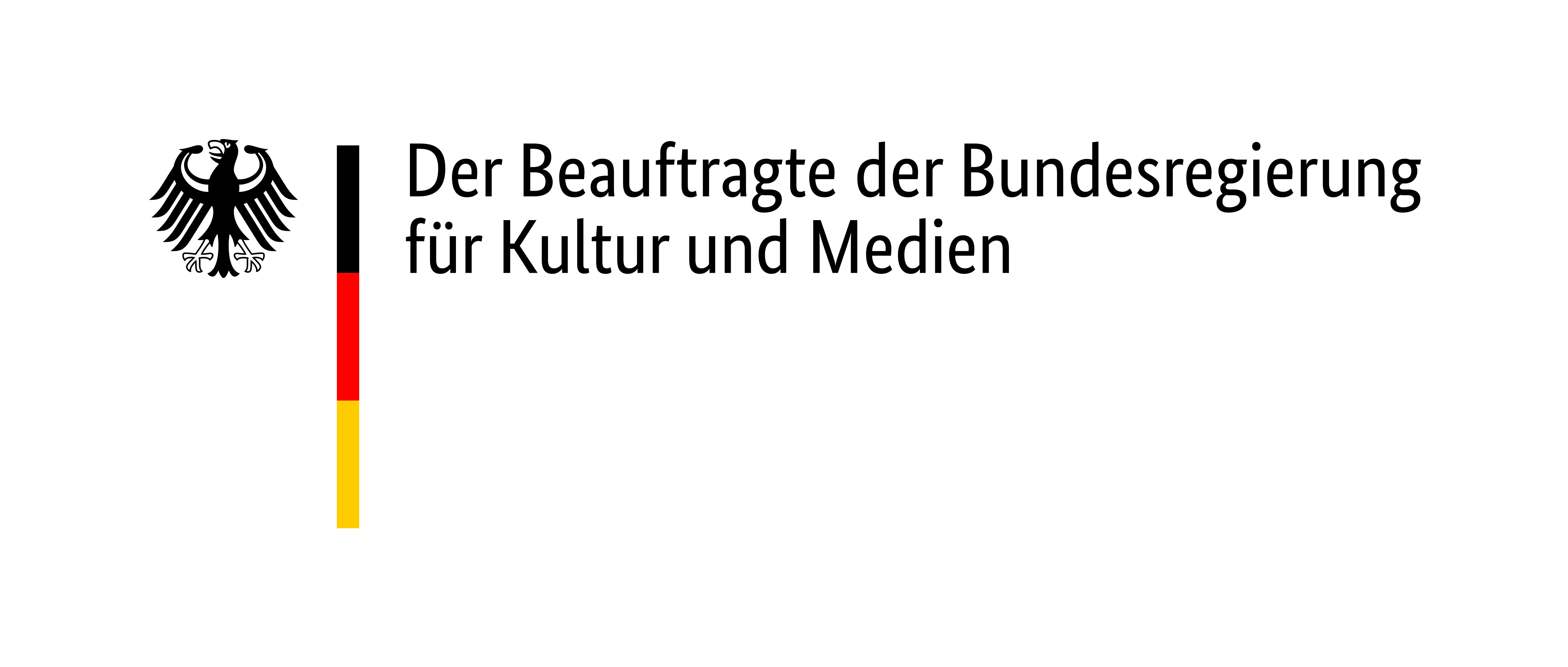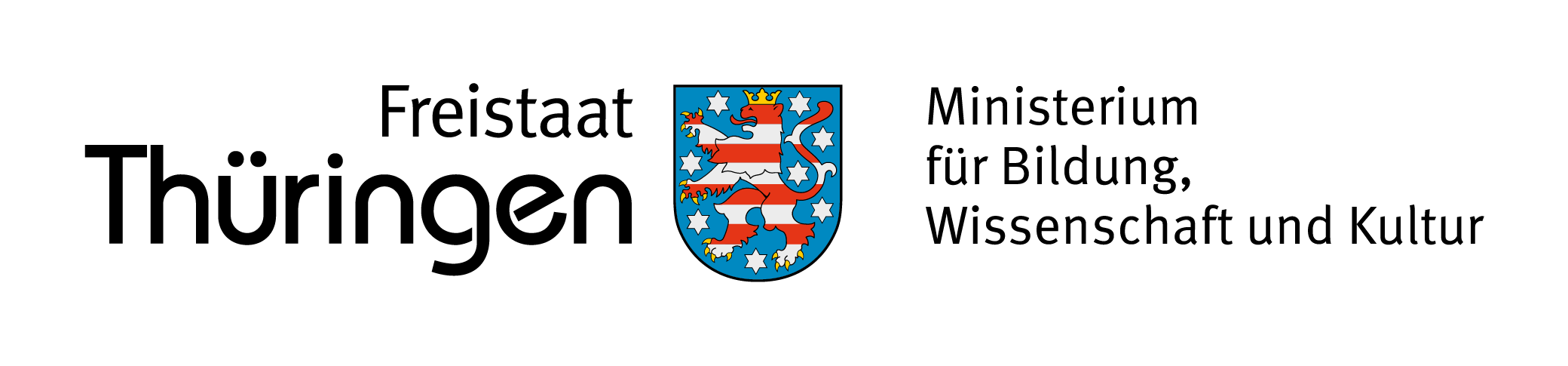Am 11. April 1945 befreiten amerikanische Soldaten die Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora. In Buchenwald befanden sich zum Zeitpunkt der Befreiung 21.000 Häftlinge, in Dora waren es nur einige Hundert. 28.000 Häftlinge aus Buchenwald, in der Mehrzahl Juden, und fast 40.000 Häftlinge aus Mittelbau-Dora hatte die SS zuvor auf Räumungstransporte und Todesmärsche geschickt. Sie befanden sich am 11. April noch in der Hand ihrer Peiniger. Manche wurden erst am 8. Mai 1945, nach der Kapitulation der Wehrmacht, befreit, wenn sie denn überhaupt überlebt hatten. Doch auch sie begehen den 11. April als den symbolischen Jahrestag ihrer Befreiung.
Mit unserer Outdoor-Ausstellung „Szenen aus dem befreiten Lager“ richten wir den Blick auf ein Thema, das am 11. April, an dem die eigentliche Befreiung und die Trauer um die Toten im Mittelpunkt stehen, manchmal etwas untergeht: die Frage, was aus den Überlebenden nach der Befreiung geschah.
Eine der wichtigsten Maßnahmen, die die befreiten Häftlinge selbst und die Amerikaner einleiteten, war die Rettung derjenigen Gefangenen vor allem im sog. Kleinen Lager, die mehr tot als lebendig in den verdreckten Baracken lagen, vollkommen ausgezehrt von Zwangsarbeit, Hunger und teils jahrelanger KZ-Haft. Die US-Armee brachte Sanitätseinheiten heran und sorgte aufopferungsvoll für die medizinische Versorgung der Kranken und Sterbenden. Trotzdem starben auch nach der Befreiung noch einige Hundert ehemalige Häftlinge an den Folgen der Haft.
Zugleich kümmerten sich die Amerikaner, unterstützt durch zivile Hilfsorganisationen, um die Heimkehr der Befreiten. Politisch Verfolgte aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden flogen sie teils noch im April in ihre Heimat aus. Schwieriger gestaltete sich die Lage für die nichtjüdischen polnischen und sowjetischen befreiten Häftlinge. Angehörige der eher nationalkonservativ ausgerichteten polnischen Heimatarmee fürchteten Repressalien 2 durch die neue kommunistische Regierung in Polen und blieben deshalb zunächst im DP Camp Buchenwald. Befreite aus der Sowjetunion wiederum standen in ihrer stalinistisch regierten Heimat unter dem Generalverdacht der Kollaboration mit den Deutschen. Sie wurden in Filtrationslager des sowjetischen Geheimdienstes gebracht, und wer den Verdacht nicht entkräften konnte, landete im Gulag.
Am schwierigsten gestaltete sich die Lage für die befreiten jüdischen Häftlinge. Die Nazis hatten vielfach alle Familienangehörigen und Freunde ermordet, ihre Dörfer und Städte im östlichen Europa waren dem Erdboden gleichgemacht. Wohin sollten sie zurückkehren? Ihre Heimat gab es nicht mehr. Es blieb nur die Auswanderung nach Palästina oder nach Übersee. In Palästina aber verhinderte die britische Mandatsmacht mit Rücksicht auf die arabische Bevölkerung die Einwanderung von Juden. Besonders erschreckend ist der Fall des Schiffes Exodus, das 5000 jüdische Flüchtlinge an Bord hatte und von den Briten 1947 am Einlaufen in den Hafen von Haifa gehindert wurde. Es folgte eine wochenlange Irrfahrt, an deren Ende die Passagiere, überwiegend Holocaust-Überlebende, von den Briten in zwei Barackenlager bei Hamburg gepfercht wurden.
Die USA wiederum, in die viele Holocaust-Überlebende emigrieren wollten, hatten restriktive Einwanderungsbestimmungen. Visa waren teuer und nur schwer zu ergattern. Auch das zwang viele jüdische KZ-Überlebende, nach der Befreiung in den DP-Camps in Deutschland zu bleiben, im Land der Täter und in einer Gesellschaft, die ihnen feindselig gegenüberstand. Erst nach der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 eröffnete sich für viele Shoah-Überlebende ein neuer Weg. Es herrschte allerdings Krieg in Israel (wie auch jetzt wieder nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023), und das hinderte viele Überlebende zunächst daran, dorthin auszuwandern.
Sehr geehrte Damen und Herren, 80 Jahre ist es nun her, dass die Überlebenden von Buchenwald und Mittelbau-Dora befreit werden.
Diesen 80. Jahrestag begehen wir in politisch nicht einfachen Zeiten. Vieles, was in den vergangenen Jahrzehnten sicher und gewiss erschien, hat sich in den letzten Jahren und Monaten geändert. Weltweit stehen die liberalen Demokratien und die Idee von den 3 unteilbaren Menschenrechten und einer humanen Gesellschaft unter Druck, nicht zuletzt auch in den USA, die bis vor wenigen Monaten noch ein Garant für die Freiheit in Europa waren.
In der Ukraine wiederum tobt nach wie vor der brutale russische Angriffskrieg, der auch die ehemaligen NS-Verfolgten mit dem Tod bedroht, so wie Holocaust-Überlebende in Israel durch den Terror der Hamas und anderer mit dem Tode bedroht werden.
Wie real diese Gefahr in der Ukraine ist, zeigt der Tod des ukrainischen Vizepräsidenten des IKBD Boris Romantschenko, der im März 2022 durch ein russisches Geschoss in seiner Wohnung in Charkiw getötet wurde. Seine Enkelin Julia Romantschenko ist heute unter uns. Sie ist aus Charkiw nach Buchenwald gekommen, um mit uns gemeinsam an die Befreiung vor 80 Jahren zu erinnern und die Toten von Buchenwald und Mittelbau-Dora zu ehren – egal, woher sie kamen, ob aus Frankreich oder Italien oder aus Russland, Belarus oder der Ukraine, egal, ob sie aus politischen oder aus rassistischen Gründen inhaftiert worden waren. Seien Sie herzlich willkommen, liebe Julia Romantschenko!
Sehr geehrte Damen und Herren, nicht nur von außen stehen die liberalen Demokratien unter Druck. Auch im Innern wird sie von ihren Gegnern angegriffen. Bei der letzten Bundestagswahl ist die AfD, aus deren Reihen notorisch geschichtsrevisionistische und holocaustverharmlosende oder sogar NS-verherrlichende Positionen vorgetragen werden, zweitstärkste Partei geworden. In Thüringen stellt sie sogar die mit Abstand stärkste Landtagsfraktion. Sicher: Nicht jeder, der die Partei gewählt hat, ist ein Rechtsextremist. Aber jeder, der sie gewählt hat, hat Rechtsextreme gewählt: Leute, die unsere Arbeit in den Gedenkstätten als „Schuldkult“ diskreditieren.
Tatsächlich erleben wir in Deutschland einen erinnerungskulturellen Klimawandel, der weit über die AfD hinausgeht und bis in die Mitte der Gesellschaft reicht. Das Bewusstsein für die Relevanz der Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen für unsere demokratische Selbstverständigung hat in den vergangenen Jahren bei vielen Menschen deutlich nachgelassen.
Das sollten wir nicht unwidersprochen hinnehmen, sondern dem Appell des französischen Buchenwald- und Dora-Überlebenden Stéphane Hessel folgen, der kurz vor seinem Tod im Jahr 2013 in einer weltweit verbreiteten Streitschrift forderte: „Engagiert Euch!“
Engagiert Euch gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Antiziganismus, gegen Muslimfeindlichkeit – und für die Demokratie, für Weltoffenheit und für eine humane und solidarische Gesellschaft, die die Menschenrechte aller achtet – überall auf der Welt.
Meine Hoffnung ist, dass der 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus zu einem Moment des Innehaltens wird und der Rückbesinnung auf die Frage, was die Befreiung 1945 und die Lehren aus der Zeit des NS und des Zweiten Weltkrieges für uns bedeutet.
Deshalb gestalten wir den 80. Jahrestag nicht nur als einen Tag des Gedenkens und der Trauer, sondern auch als einen Tag der Begegnungen und des gemeinsamen Nachdenkens über die Frage, in welcher Gesellschaft wir eigentlich in Zukunft leben wollen. Danke, dass Sie uns dabei begleiten.